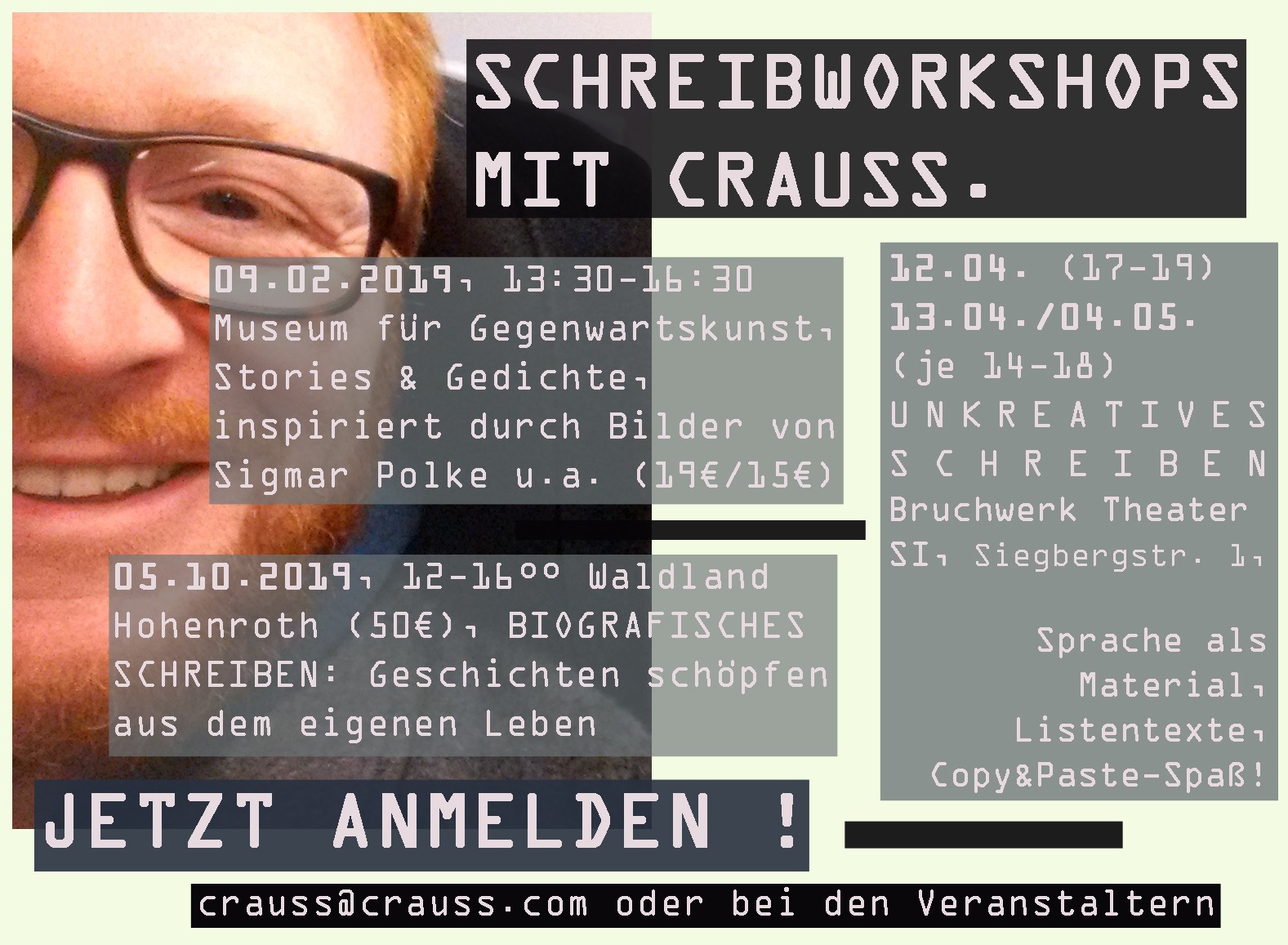schauen Sie sich ältere lexika an, dort treffen Sie auf einen anderen blickpunkt. [W.G. SEBALD]
SCHÖNER SCHREIBEN
SCHÖNER SCHREIBEN, METHODEN 5
nichts was Sie sich ausdenken wird so haarsträubend sein wie das, was Sie von anderen menschen erzählt bekommen. [W.G. SEBALD]
SCHÖNER SCHREIBEN, METHODEN 4
ich könnte Ihnen etwas von random-elementen in meinen texten erzählen und dass ich mein wortmaterial auflade, atomisiere, deformiere, dass ich collagen… mache, dass ich verba substantiviere, substantiva verbalisiere, dass ich eine armee von satzzeichen einsetze, um sie attackierend, lockend, besänftigend [verzögernd] funktionieren zu lassen, dass ich wiederholungen verwende, vor allem als leitmotive, dass eines meiner hauptanliegen darin besteht, disparates zu harmonisieren. [F. MAYRÖCKER]
SCHÖNER SCHREIBEN, METHODEN 3
SCHÖNER SCHREIBEN, METHODEN 2
SCHÖNER SCHREIBEN, METHODEN 1
SCHÖNER SCHREIBEN, METHODEN: anlässe
die formulierte welt mit halbem ohr hören, und so das zeremonium verquer stellen, heisst doch wohl: die welt anders zusammensetzen, sie schräg von unten oder halbwegs links von oben sehen – heisst doch wohl: in diesem moment einmal wieder sehen. [ERNST JANDL]
SCHÖNER SCHREIBEN, METHODEN: haltung/ herangehensweise 2
schreiben heisst, bisher unerhörte/ nicht gesehene dinge zu entdecken. geht es nicht darum, besteht kein anlass zu schreiben.
sei unbedingt experimentierfreudig – aber lass den leser an deinem experiment teilhaben. schreibe über obskure dinge, aber sei nicht selbst obskur. [W.G. SEBALD]
SCHÖNER SCHREIBEN, METHODEN: haltung/ herangehensweise 1
ich schalte, um meine maschine in gang zu bringen, auf erinnerungspunkte irgendwelcher vergangenheit, bringe dadurch etwas ganz intensiv in die mitte meines bewusstseins, wo es lebendig dasteht, zu sehen, hören, riechen, betasten, und in einer eigenbeweglichkeit, die es aus dem zustand des eingebettetseins in einen erinnerungsablauf befreit. [F. MAYRÖCKER]
nicht das wahrnehmen eines zufälligen erinnerungsfetzens also, sondern ein aktives hinwenden an den gegenstand der erinnerung, sodass er „beweglich“ wird, also nicht als erinnertes beschrieben werden muss, sondern als gegenwärtiges, gerade im augenblick vorhandenes.
SCHÖNER SCHREIBEN, sprache, gestus, stil 6
form 3
vermeiden Sie adjektive; sie blähen eine geschichte allzu sehr auf, wo man mit starken verben ebensoviel erreicht: er verschlang die nudeln statt er aß laut und ungeduldig die nudeln
SCHÖNER SCHREIBEN, sprache, gestus, stil 5
form 2
lange sätze bewahren Sie davor, andauernd die figur beim namen zu nennen (Gertie tat das, Gertie fühlte jenes). andererseits kann sich eine noch so banale handlung leicht in zu langen sätzen verheddern.
benutzen Sie das wort und so selten als möglich, versuchen Sie, sätze variantenreich zu verbinden.
SCHÖNER SCHREIBEN, sprache, gestus, stil 4
form 1
machen Sie unbedingt absätze. kleine happen lassen sich besser verdauen. auf einer grossen, einheitlichen textfläche gleitet das auge aus – und aus dem text heraus.
SCHÖNER SCHREIBEN, sprache, gestus, stil 3
achten Sie darauf, ein unmotiviertes oszillieren der erzählzeit zu vermeiden. wenn Sie in der vergangenheitsform beginnen, sollten Sie auch mit ihr enden. tempuswechsel können sinnvoll, müssen aber motiviert sein. ein (befristeter) wechsel von präteritum in präsens kann einer story mehr geschwindigkeit/ „näheres dransein“ an der aktion verleihen (zb wie bei einem live-reporter).
SCHÖNER SCHREIBEN, sprache, gestus, stil 2
dialekte macht aus normalen wörtern eine andere, seltsame sprache (zb. ‚Jessas’ für ‚Jesus’). [W.G. SEBALD]
SCHÖNER SCHREIBEN, sprache, gestus, stil 1
erzählen Sie mehr, aber formulieren Sie weniger!
jeder satz für sich genommen sollte etwas bedeuten. eine schrift sollte nicht den eindruck vermitteln, dass der verfasser poetisch sein wollte. [W.G.SEBALD]
es bedeutet etwas anderes, ob eine frau sagt ich bin schwanger, oder ob sie sagt: ich bekomme ein kind – und es verändert den impuls, ob sie es zu ihrem mann oder zu einem liebhaber sagt!
SCHÖNER SCHREIBEN, figuren und charaktere 10
seltsame begebenheiten sind interessant für die handlung [W.G. SEBALD]
es ist stets befriedigend, beim lesen einer geschichte etwas zu lernen. Dickens hat das eingeführt: der essay brach in den roman ein. dennoch sollte man „fakten“ im roman nie trauen – sie bleiben, trotz allem, fiktion. [W.G. SEBALD]
SCHÖNER SCHREIBEN, figuren und charaktere 9
es gibt zwei möglichkeiten, eine handlung zu entwickeln:
- erst existiert die story, dort hinein wird die figur geschrieben. sie entwickelt sich sozusagen an der handlung entlang (zb Rocky: ausgebrannter boxer erhält die chance zum comeback)
- zunächst existiert eine figur, aus deren charaktereigenschaften/ konflikten mit der umwelt sich eine handlung ‚ergibt’
SCHÖNER SCHREIBEN, figuren und charaktere 8
in einer geschichte kommen meist zwei arten von handlung vor:
- eine physische aktion (zb. ein diamantenraub / eine verfolgungsjagd);
- andererseits aber auch eine emotionale aktion, die sich aus der physischen speisen oder sie bestimmen kann. wie geht es der figur, was denkt sie ohne es zu äussern?
SCHÖNER SCHREIBEN, figuren und charaktere 7
das äussere leben speist sich aus dem inneren leben und aus einer backstory wound (schlagen Sie den begriff in einem lexikon für filmbegriffe nach): etwas, das der figur vormals geschehen ist, nicht erzählt wird, sondern aus dem erzählten geschlossen werden kann und ihr handeln oder denken bestimmt.
„man denke etwa an den prolog von Faulkners the sound and the fury (1929, dt: schall und wahn): eine ganze familiendynastie wird kurz und knapp skizziert, ihre vergangenheit, gegenwart und mögliche zukunft, eine ahnengalerie, die einzelnen personen in ihrer originalität, ob sie nun im eigentlichen roman noch auftauchen oder nicht. aber klima und milieu sind dadurch vorab definiert.“ [E. Stahl, diskurspogo, 117]
SCHÖNER SCHREIBEN, figuren und charaktere 6
das (von anderen figuren sichtbare) äussere leben wird in der erzählten story vermittelt.
was man einer figur maximal zumuten kann, hängt unter anderem von der art des textes ab. die fallhöhe einer handlung (mehr staffage als story/ unrealistischer verlauf) vergrössert sich, je mehr man seinen figuren zumutet.
SCHÖNER SCHREIBEN, figuren und charaktere 5
die figur hat ein inneres leben, auch wenn der text nicht explizit davon spricht. sie hat eine vorgeschichte von ihrer ‚geburt’ bis zum beginn der erzählten story; diese biographie formt ihren charakter!
SCHÖNER SCHREIBEN, figuren und charaktere 4
das wetter ist durchaus nicht überflüssig in einer geschichte (W.G. Sebald). es kann das gemüt der figur beeinflussen oder eine handlung verstärken/ unterstreichen (wie zb. in Karen Duves regenroman) oder James Lee Burkes mississippi jam:
»es war ein merkwürdiger tag auf dem meer gewesen. der wind kam heiss und trocken aus dem süden, und in der dünung waren die glänzenden rücken von stachelrochen und die bläulich-rosafarbenen luftsäcke von quallen zu sehen, was bedeutete, dass sie wahrscheinlich von einem sturm landeinwärts richtung küste getrieben wurden. dann fiel das barometer, der wind legte sich schlagartig, und die sonne sah aus wie eine weisse flamme, die im stillen wasser gefangen war. es regnete nur gerade mal fünf minuten, grosse, fette tropfen, die wie bleischrot aufs wasser schlugen, dann war der himmel auch schon wieder klar und heiss.«
SCHÖNER SCHREIBEN, figuren und charaktere 3
figuren brauchen details, die sie im gedächtnis des lesers verankern (W.G. Sebald). beispiel: „der busfahrer war ein dicker karpfen mit einem schnurrbart.“
die romanschriftsteller irren sich, wenn sie glauben, dass ihre leser sich immer wieder die mühe nähmen, die von ihnen sorgfältig beschriebenen gesichter im geiste nachzuzeichnen.
wenn ich lese, sein kopf glich einer umgekehrten zwiebel, so habe ich sofort ein bild; wenn es aber heisst, sein haar war braun, seine stirn niedrig, seine nase schön geschwungen, sein mund grob aufgeworfen, so geht das – an mir wenigstens – ziemlich spurlos vorüber. Christian Morgenstern 1906
William Gaddis‘ werk a frolic of his own (1994, dt: letzte instanz) „besteht nahezu vollständig aus hypernaturalistisch geformten dialogen. selbstverständlich bilden die redebeiträge in diesem roman die wirklichkeit nicht etwa 1:1, nach art eines fiktiven tonbandmitschnitts ab, diese dialoge wirken nur so, als ob. es ist eine vom autor ästhetisch gesteuerte realität. jeder figur seines romans verleiht Gaddis eine unverwechselbare sprecherphysiognomie, sodass er ganz ohne narrative personenzuweisungen auskommt.
anders dagegen James Lee Burke in mississippi jam: »eine flachbrüstige schwarze, wahrscheinlich eine polizistin in zivil, mit dünnen armen und einem mund voller goldzähne diskutierte lautstark mit [Nate]. ihre zerknitterte braune bluse hing lässig über einer dunkelblauen hose. ihr make-up war vom regen verschmiert, und sie trug halbschuhe ohne socken. Nate Baxter versuchte, sich von ihr abzuwenden, doch sie folgte ihm, hatte ihre hände in die schmalen hüften gestemmt, und ihr mund öffnete und schloss sich im strömenden regen.«
SCHÖNER SCHREIBEN, figuren und charaktere 2
auch wenn Sie von sich selbst schreiben: unbedingtes abgewöhnen des ICH: FIGUREN erfinden! so entstehen texte, in denen nicht nur dem ICH etwas passiv geschieht, sondern personen, die aktiv und bewusst handeln. (zuviel ichizismus)
schaffen Sie originale figuren! jeder mensch ist individuell, daher sollten auch charaktere in geschichten einzigartig sein. verwechseln Sie > originalität aber nicht mit originell (ausschliesslich aus einer oder mehrenen auffälligkeiten bestehende figur).
SCHÖNER SCHREIBEN, figuren und charaktere 1
erst nachdem der ort festgelegt ist, treten die figuren auf.
der ort kann durch ein winziges detail bestimmt werden, etwa: „er sitzt still“ (offener oder geschlossener raum, stuhl oder bank, fokus auf einem einzigen sitzplatz)
SCHÖNER SCHREIBEN, ort und zeit
ort und zeit sind die knackpunkte der narrativen künste:
alles geschieht gleichzeitig, der autor muss sich aber notgedrungen auf eine reihenfolge festlegen.
um sich nicht gleich am anfang zu verheddern, muss der autor eine rigorose entscheidung treffen, indem er etwa den ort mit namen nennt oder ihn durch die zeit kennzeichnet: wien, jetzt, wolkenbruch, im aufzug, der wecker klingelt…
ort und zeit gehören zusammen.
im „wirklichen leben“ steht der ort ebenfalls an erster stelle. wird gefragt: wer bist du, so ist das eine frage nach dem woher kommst du. (TEREZIA MORA)
einen sinn für orte und plätze zu haben, beeinflusst eine handlung. es kann sich bei einem beschriebenen ort um ein destillat aus mehreren orten handeln. man braucht einen guten grund, den ort der handlung nicht zu beschreiben. (W.G. SEBALD)
üben Sie sich in anfängen von geschichten: schauen Sie nach, wie berühmte stories beginnen
SCHÖNER SCHREIBEN, erzählstruktur
eine enge erzähl- oder handlungsstruktur eröffnet möglichkeiten. nehmen Sie ein erzählmuster oder ein genre und schreiben Sie sich aus ihm heraus. (W.G. Sebald)
Karen Duves regenroman ist zu beginn ein krimi, in der mitte erotisch und ein ganz anderer krimi am Ende.
SCHÖNER SCHREIBEN ist korbflechterei
eine gute zeichnung muss wie ein flechtkorb sein, aus dem man keinen halm herausnehmen kann, ohne ein loch zu hinterlassen.
—Henri Matisse 1939